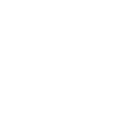Sie haben Philosophie studiert und dann einen Abschluss in Umweltingenieurwesen gemacht — eine nicht alltägliche Kombination von Studienfächern. Wie kam es dazu?
Für mich, geboren in Oberschlesien, in Gliwice, scheint dies ein ganz natürlicher Bildungsweg zu sein. In einer von Abgasen und Staub geprägten Umgebung, in der der Schnee nicht weiß und der Himmel nicht immer sichtbar war, war es klar, dass das Wichtigste für jeden von uns die Umwelt ist, in der wir leben. Nach dem Abitur mit geisteswissenschaftlicher Ausrichtung beschloss ich, den Geheimnissen der menschlichen Existenz auf den Grund zu gehen und habe mit großer Leidenschaft Philosophie studiert. Nachdem ich mich immer mehr mit der uns umgebenden Umwelt befasst hatte, begann ich schließlich Ingenieurtechniken zu studieren, um damit zum Erhalt der Natur beizutragen. Dies ermöglichte mir eine interessante Anstellung in einem wissenschaftlichen Institut und später in einem internationalen Unternehmen in der zentralen Abteilung für Umweltschutz.
1985 sind Sie aus dem kommunistischen Polen in die damalige Bundesrepublik Deutschland ausgewandert. War das eine schwierige Entscheidung?
Es herrschte große Verzweiflung, in Polen war gerade das Kriegsrecht beendet worden, jedoch schienen die Hoffnungen auf ein normales Leben in der Zivilgesellschaft aussichtslos. Zu dieser Zeit wurde mein Sohn Michał geboren, und unsere fünfjährige Marta hatte Probleme mit der oberschlesischen Luft. Ich war fasziniert von dem sich vereinigenden Europa und so war der Entschluss, das Land zu verlassen, schnell gefasst. Ich unterbrach mein Promotionsstudium und machte mich auf den Weg ins Ungewisse, ohne meine polnische Identität aufzugeben.
Haben Sie sich sofort für die Polonia engagiert? Warum?
Das Polentum liegt mir in den Genen und ist für mich etwas Besonderes. Natürlich ist der Neuanfang als Emigrant nicht einfach. Am Anfang ist es wichtig, sich zu integrieren, die Sprache zu beherrschen und eine Arbeit zu finden, die mit der eigenen Ausbildung vereinbar ist und von der man in dem Land seiner Wahl anständig leben kann. Damals war es schwierig von polnischen Gemeinschaftsstrukturen zu sprechen. Die neu entstandenen Pfarrgemeinden dienten als Orte der Begegnung. Von der Polonia war damals nicht die Rede. Die polnischen Emigranten schienen orientierungslos und gaben ihre Herkunft nicht zu erkennen. Man schämte sich dafür. Andererseits gab es befreundete Gruppen von Menschen aus Polen, die großartige Treffen und Veranstaltungen organisierten.
Wie hat sich die deutsche Polonia im Laufe der Jahre entwickelt? Was waren die wichtigsten Wendepunkte?
Erst mit der Unterzeichnung des Deutsch-Polnischen Nachbarschaftsvertrages von 1991 begannen sich klare Strukturen der polnischen Gemeinschaft in Deutschland herauszubilden, die mit der Hoffnung auf eine Gleichbehandlung der deutschen Minderheit in Polen und der in Deutschland lebenden Polen verbunden waren. Neben den bereits bestehenden historischen Verbänden der Polen „Rodło“ und „Zgoda“ entstanden weitere Dachverbände wie der Polnische Kongress in Deutschland, das Christliche Zentrum zur Förderung der polnischen Sprache, Kultur und Tradition in Deutschland sowie der Bundesverband Polnischer Rat in Deutschland e. V. Im Jahr 1998 schlossen sich alle fünf Dachverbände zum Konvent der Polnischen Organisationen in Deutschland zusammen, der einzigen Vertretung der polnischen Gemeinschaft gegenüber der polnischen und der deutschen Regierung. Nur „Rodło“ ratifizierte die zuvor unterzeichnete Gründungsurkunde des Konvents nicht und wurde so zu dessen Opposition.
Im Jahr 2011 haben Sie die Polonia in Deutschland am Runden Tisch vertreten und waren einer der Unterzeichner der Abschlusserklärung. Wie sind die Beratungen damals verlaufen, welche Themen standen im Vordergrund? Konnten alle Pläne, die damals vereinbart wurden, umgesetzt werden?
Sicherlich war der Vertrag von 1991 für die in Deutschland lebenden Polen mit Hoffnungen verbunden. Aber weil die polnische Seite etwas zu schnell alle Rechte der deutschen Minderheit in Polen verwirklichte, hatte es die deutsche Seite nicht eilig, sich angemessen um die Polonia und die Polen zu kümmern und ihre Rechte mit denen der in Deutschland lebenden Minderheiten gleichzustellen. Erst die „Gemeinsame Erklärung des Runden Tisches“ vom Juni 2011, die zum 20. Jahrestag des Vertrags von 1991 unterzeichnet wurde, gab uns wieder Hoffnung auf eine gewisse Symmetrie. Für die polnische Gemeinschaft waren dies jedoch nur die sprichwörtlichen Brotkrümel, die vom Tisch fielen. Zwar wurde unter anderem die Geschäftsstelle der Polonia in Berlin eingerichtet, aber deren materielle Situation ist unsicher und von Jahr zu Jahr ungewiss. Hinzu kommt, dass die Entwicklung der Geschäftsstelle kontrolliert wird und ihre Aktivitäten bis heute nicht außerhalb der Mauern des Bundesministeriums des Innern und für Heimat (BMI) stattfinden dürfen, was den alltäglichen, lebendigen Kontakt mit der polnischen Gemeinschaft deutlich erschwert. Dagegen ist das eingerichtete Dokumentationsportal PORTA POLONICA ein Erfolg. Die im Abkommen von 2011 geforderte Berliner Gedenkstätte für alle Polen, die Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung wurden, ist bisher nicht errichtet worden. Deshalb unterstützen wir hoffnungsvoll das sich abzeichnende Konzept eines Orts des Gedenkens in der lebendigen Form des Deutsch-Polnischen Hauses. Gleichzeitig wollen wir, dass die Geschäftsstelle der Polonia als Vertretung der polnischen Gemeinschaft in Deutschland an der weiteren konzeptionellen Arbeit beteiligt wird. Dies ergibt sich auch aus den Bestimmungen der bereits erwähnten „Gemeinsamen Erklärung des Runden Tisches“ bzgl. einer breiteren „Einbindung polnischer Vertreter in Beratungsgremien der Gedenkstätten nationalsozialistischer Gewaltherrschaft“.
Was die polnische Sprache in Deutschland betrifft, so beschloss der Runde Tisch lediglich, dass der neu eingerichtete Deutsch-Polnische Ausschuss für Bildungszusammenarbeit unter der Schirmherrschaft der Deutsch-Polnischen Regierungskommission und unter Beteiligung der Polonia-Organisationen eine „Strategie für den Polnischunterricht als Muttersprache“ entwickeln sollte. Im Jahr 2013 wurde die Strategie als Beschluss der Kultusministerkonferenz veröffentlicht. War zu diesem Zeitpunkt eine direkte Finanzierung des Polnischunterrichts aus Bundesmitteln ausgeschlossen?
Das ist eine sehr gute Frage. Eine Strategie für den Unterricht der polnischen Sprache wurde in den Unterausschüssen des Runden Tisches heiß diskutiert, woraufhin veröffentlicht wurde, was allgemein bekannt ist, dass auf Bundesebene keine Regelung möglich ist, da der Sprachunterricht in die Zuständigkeit der einzelnen Länder fällt. Wir haben daraufhin der deutschen Seite vorgeschlagen, auf Bundesebene einen Fonds einzurichten, ähnlich dem bestehenden Fonds für polnische Kulturprojekte bei der Bevollmächtigten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM). Erst die, auch für uns als Polonia, nicht nachvollziehbare radikale Maßnahme, den Deutschunterricht für die deutsche Minderheit in Polen von drei auf eine Stunde zu reduzieren, hat den deutschen Politikern die Notwendigkeit einer umfassenden Förderung des Polnischunterrichts in Deutschland vor Augen geführt. Deshalb wurde, meiner Meinung nach besser spät als nie, auf Bundesebene ein Fonds zur Förderung des Polnischen als Herkunftssprache eingerichtet, der von KoKoPol verwaltet wird, das wir sehr unterstützen und mit dem wir täglich zusammenarbeiten.
Welche Themen wird der Konvent der Polnischen Organisationen in Deutschland in den für 2024 geplanten Regierungskonsultationen ansprechen?
Wir freuen uns über die Neuaufnahme der Regierungskonsultationen und haben hier sehr konkrete Vorschläge. In den Forderungen der Polonia, die bei dem VI. Kongress der polnischen Organisationen 2023 in Bonn beschlossen wurden, werden mit Sicherheit einige wichtige Aspekte und Themen enthalten sein, sei es der Ausbau der Geschäftsstelle der Polonia oder die konkrete Beteiligung an der Realisierung des Deutsch-Polnischen Hauses in Berlin. Auch der bevorstehende 35. Jahrestag der Unterzeichnung des Deutsch-Polnischen
Vertrags im Jahr 2026 wird ein Thema sein. Seitdem hat sich in Europa viel verändert, und Polen ist ein fester Bestandteil der Europäischen Union geworden. Es wäre daher angebracht, unseren Vertrag von 1991 zu aktualisieren und ihn, wie den deutsch-französischen Elysée-Vertrag von 1963, durch ein zusätzliches Abkommen zu ergänzen, vergleichbar mit dem deutsch-französischen Abkommen, das 2017 im Krönungssaal in Aachen unterzeichnet wurde. Ich würde es sehr begrüßen, wenn ein ergänzendes Dokument zum Deutsch-Polnischen Vertrag von 1991 ebenfalls in diesem Krönungssaal, in der Stadt Karls des Großen und der europäischen Hauptstadt der Polonia, wo der europäische Polonicus-Preis feierlich verliehen wird, unterzeichnet würde. Dies wäre ein großartiger Akt in der Größenordnung des gerade erst erneuerten Weimarer Dreiecks.
Polonicus ─ der Preis der europäischen Polonia, den Sie 2009 initiiert haben, steht unter dem Motto: Ut honoremur ab aliis, ipsi nos honoremus ─ Lasst uns einander respektieren und wir werden respektiert werden. Warum dieses Motto?
Das Wesentliche des Polonicus-Preises ist sein europäischer Charakter. Er bringt heute diejenigen zusammen, für die das Projekt eines gemeinsamen Europas sehr wichtig ist, denn nur ein gemeinsames Europa kann uns ein Leben in Frieden und Wohlstand bieten. Ich halte es für ausgesprochen wichtig, dass die Polonia die Aktivitäten möglichst vieler Menschen anerkennt, die dazu beigetragen haben. So sind wir im Umgang mit unseren Freunden in Deutschland und ganz Europa im Bewusstsein unserer eigenen Würde alle auf Augenhöhe. Mit einem so ausgeprägten Selbstbewusstsein hat die Polonia das Potenzial, zum Aufbau der europäischen Zivilgesellschaft beizutragen. Gegenseitiger Respekt ist für uns alle sehr wichtig, denn er verleiht uns, poetisch gesagt, Flügel zum Fliegen, welche sich ebenfalls in der Skulptur des Polonicus-Preises widerspiegeln. Ich möchte daran erinnern, dass bisher mehr als 50 Auszeichnungen an Persönlichkeiten, Institutionen und verschiedene Initiativen in Europa verliehen wurden, die für die Polonia von großer Bedeutung sind. Der Polonicus-Preis verdeutlicht, wie wichtig es für die Polonia ist, dass Polen zur Europäischen Union gehört, und dies seit 20 Jahren!
Auszeichnungen:
2012 — Ehrenmedaille „Bene Merito“ für Aktivitäten zur Förderung der polnichen Kultur im Ausland, verliehen vom polnischen Außenminister Radosław Sikorski / 2015 — Offizierskreuz vom Staatspräsidenten Bronisław Komorowski für Verdienste zur Popularisierung von Polen in Europa / 2022 — Bundesverdienstkreuz am Bande vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier für das Engagement für die deutsch-polnichen Beziehungen
Interviev:: Dr. Phil.. Magdalena Telus / KoKoPol
https://kokopol.eu/wp-content/uploads/2024/05/Polonus_09_web.pdf