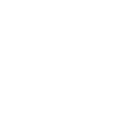Europa im Griff der globalisierten Welt
Europa im Griff der globalisierten Welt
Nach dem britischen Referendum über den Austritt aus der EU sowie mit dem Ausgang der Präsidentschaftswahlen in den Vereinten Staaten müht sich Europa nach Kräften um eine Übereinkunft darüber, welche weiteren Schritte nun richtungsweisend sein könnten. Europa ist nach diesen beiden politischen Einschnitten in ihren Grundfesten erschüttert und sieht sich zu einer Atem- und Bedenkpause genötigt, um den eigenen Platz in der globalisierten Welt und die Beziehungen mit den übrigen Akteuren der internationalen Politik ebenso wie die derzeitige Verfasstheit der Gemeinschaft nochmals gründlich zu überdenken. Man kann es auch so sehen: Die EU hat die „amerikanische“ und die „britische“ Lektion als eigene Hausaufgaben aufzufassen und selbständig zu bewältigen. Im Folgenden möchte ich mich auf just diese Lektionen und daran anknüpfende Aufgaben konzentrieren, da sie mit Blick auf die Zukunft der EU und somit auf die Zukunft Polens gewisse Auswirkungen mit sich bringen und einige damit einhergehende Schlüsse zulassen.
 Amerikanische Lektion
Amerikanische Lektion
Nach den letzten US-Wahlen zeichnet sich ein Trend ab, die eingespielten Regeln der transatlantischen Zusammenarbeit, wie sie aus der Nachkriegsordnung hervorgegangen ist, und die Rolle internationaler Institutionen grundsätzlich infrage zu stellen. Dies geschieht ungeachtet dessen, dass beides jahrzehntelang den Frieden sicherte und den freien Handel förderte. Jetzt sollte es gezielt gelockert werden, um das Feld den Supermächten, darunter auch solchen mit regionaler Wirkungskraft, zu überlassen, damit diese über bilaterale Verträge und auf der Basis eigener Wertevorstellungen die bestehende Weltordnung untereinander neu vermessen und aushandeln können. So wie es schon in der Vergangenheit manchen multilateralen Strukturen ergangen war, die zur bloßen Fassade verkamen und rasch überholt erschienen, könnte die Union genauso an ihrer Anziehungskraft und Orientierung verlieren und schrittweise den Zerfall ihrer Integrationsfähigkeit erleben. Man ist daher gut beraten, dies frühzeitig zu erkennen und sich darauf gefasst zu machen, bilaterale Beziehungen mit den Supermächten einzugehen. Gleichzeitig muss man einsehen, dass einem System, welches sich auf transaktionäre Deals stützt und seine Existenzberechtigung von einer eng begriffenen Nutzenmaximierung, von Protektionismus und dem Recht des Stärkeren ableitet, wenig entgegenzusetzen ist.
In der westlichen Welt herrscht aktuell eine Stimmung vor, die sich gegen die Eliten richtet. Das liberale Rezept gegen wirtschaftliche und gesellschaftliche Probleme, die etwa mit der Migrationsfrage zusammenhängen, wird massiv in Zweifel gezogen. Dies alles wird überlagert von kritischen Debatten über soziale Auswirkungen der Systemtransformation in den neuen EU-Mitgliedstaaten. Angesichts dieser Entwicklungen haben in Ostmitteleuropa alternative Entwicklungskonzepte an Zuspruch gewonnen. Diese gehen davon aus, dass sowohl internationale als auch europäische Institutionen zusehends an Bedeutung verlieren werden.
Hingegen stellen etliche Verfechter der liberalen Demokratie die Frage, ob es sich denn wirklich lohne, die so mühsam erarbeiteten Erfolge der internationalen Institutionen generell anzuzweifeln. Sei es denn wirklich ratsam, in die Zeit der wie auch immer gearteten Vorherrschaft der Supermächte und des Protektionismus zurückzufallen? Man wisse ja sehr wohl darum, wie so etwas in der Regel endete. Sei es denn wirklich von Vorteil, ein System aufzugeben, das auf gegenseitigen solidarischen Verpflichtungen und der gemeinsamen Entscheidungsfindung basiert? In Anbetracht solcher Herausforderungen hat Europa den neuen Spielregeln eine klare Absage erteilt und setzt seitdem beharrlich auf das bisherige Vorgehen. Europa gab zu Protokoll, es wolle an einer Zukunftsvision arbeiten, die den europäischen Regeln entspricht. Es weiß ja um seine eigene Konkurrenzfähigkeit, die nicht trotz, sondern ausgerechnet wegen der Einhaltung solcher Regeln möglich ist. So ist es beispielsweise bekannt, dass Investoren Länder mit stabilen demokratischen Institutionen bevorzugen. Dies geschieht nicht zuletzt deshalb, weil solche Länder bessere Rahmenbedingungen für Innovationen bieten. Wer denn sonst, wenn nicht die Europäische Union, kann ein internationales Bündnis gründen, das stark genug wäre, sich den protektionistischen Allheilmitteln in den Weg zu stellen? Oder: Wer ist denn überhaupt in der Lage, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um sich der dunklen Kehrseite der Globalisierung entgegenzusetzen, die Verlierer des freien Handels in Schutz zu nehmen und auf die Einhaltung sozialer Standards zu pochen?
Es ist doch die Europäische Union, die jährlich 87 Milliarden Dollar für Entwicklungshilfe bereitstellt, während die Vereinigten Staaten für diesen Zweck, der ja ein unverzichtbarer Bestandteil jeder Politik zur Krisenprävention und Konfliktvorbeugung ist, lediglich 31 Milliarden Dollar ausgeben. Die EU stellt unter Beweis, dass sie bereit ist, den Benachteiligten und Bedürftigen dieser Welt eine helfende Hand entgegenzustrecken, und sei es etwa in Bangladesch, das dank der die Entwicklung des Landes fördernden EU-Nullzölle seine Waren im Wert von 15 Milliarden Euro in die Länder der Gemeinschaft exportiert. Die EU kooperiert überdies mit wirtschaftlich angeschlagenem Jordanien, das allein Millionen Geflüchtete aus Syrien aufgenommen hat. Die umfänglichen Hilfen der EU für das Land gelten vor allem den Maßnahmen zur Arbeitsvermittlung für Geflüchtete. Es gibt in den anderen Weltregionen nicht viele Länder, die sich über solche strategischen Hilfen unbedingt den Kopf zerbrechen, zumal in einer erneuten Phase des um sich greifenden nationalen Eigensinns. Werte und Verantwortungsgefühl bleiben weiterhin eine „Währung“, die Europa mit Erfolg einsetzen und sich so Wettbewerbsvorteile verschaffen kann. An alle polnischen Befürworter einer Entwicklung, an deren Ende die Union infolge der Vorherrschaft wirtschaftlicher und politischer Supermächte obsolet sein würde, sei diese Anmerkung erlaubt: Bei der Bilanz direkter ausländischer Investitionen in Polen werden die USA mit 2,5 Prozent (Deutschland dagegen mit 20 %) und bei der Handelsbilanz mit drei Prozent ausgewiesen (der Anteil Deutschlands hingegen wird mit 25 % beziffert).
Beim Gipfeltreffen im Juli 2018 zwischen den Präsidenten der USA und Russlands in Helsinki wurde ein neues Kapitel des Dramas aufgeschlagen. Beim Thema Sicherheit müssen daher die transatlantischen Beziehungen auf der Prioritätsliste für Europa ganz oben stehen. Aber Präsident Trump trägt seine Absichten offen zur Schau, die europäische Integration zu zerschlagen; dass Wladimir Putin es schlecht mit der EU meint, ist ebenfalls längst bekannt. In dieser Lage geht ein EU-Mitgliedsland, welches beim Ausbau seiner Beziehungen mit Washington auf die „antieuropäische“ Karte setzt, ein enormes Risiko ein. Ja, es ist geradezu ein todesmutiges Handeln. Wenn man bei dieser Frage – Schwächung der Europäischen Union bei gleichzeitiger Umkehrung der Weltordnung – vermutet, beide Weltmächte agierten Hand in Hand, muss man sich vergegenwärtigen, dies würde unweigerlich zur Wiederherstellung russischer Einflüsse in der ganzen Region führen. Mit anderen Worten: Die Sicherheit der Länder unserer Region wäre in Gefahr.
Ohne den EU-Schutzschirm würden europäische Länder zu zweitrangigen Spielern auf dem Schachbrett der Weltgeschichte verkommen. Gegen Sicherheitsgarantien würden sie von den Weltmächten gegeneinander ausgespielt werden, die sie im Gegenzug dazu verdonnern würden, ihren eigenen Interessen Folge zu leisten und dabei eine grenzenlose Loyalität an den Tag zu legen. Wie Andrzej Halesiak in der Tageszeitung „Rzeczpospolita“ (20.06.2017) ausführte, wird das globale Klima für kleine und mittelgroße Staaten, die in ruhigeren Zeiten bei Militärausgaben sparen und von der Liberalisierung des Handels ebenso wie vom freiem Technologietransfer profitierten, zunehmend unangenehm. Wenn die politischen Spannungen wachsen und internationale Institutionen geschwächt werden, werden die Belange dieser Welt komplizierter. Dazu gehört zudem die Rücksicht darauf, dass die Frontlinien bei der Verteidigung eigener Interessen heutzutage einerseits zwischen den einzelnen Staaten verlaufen, andererseits immer deutlicher sogar zwischen den Staaten und den internationalen Großkonzernen. Derzeit, so Halesiak, gebe es für kleine und mittelgroße Länder „keine günstigen Rahmenbedingungen, um das politische Spiel auf eigene Rechnung zu betreiben“.
Angesichts all dieser Trends kann man der Ansicht sein, die Rolle der EU in der globalen Wirtschaftspolitik werde nicht kleiner, sondern könne eher noch an Gewicht gewinnen. Stabiles Wachstum und klare Anzeichen für die Überwindung der Krise in der EU (endlich wurden die erwarteten Investitionsprogramme aufgelegt) werden obendrauf die Wiederherstellung der Bedeutung Europas mit seinen spezifischen Soft-Power-Ressourcen auf der internationalen Bühne begünstigen. Über alle Erwartungen hinaus haben in der letzten Zeit viele Staaten ihre Bemühungen intensiviert, mit der EU Handelsverträge abzuschließen. Und in den wirtschaftsnahen Kreisen der EU-Länder selbst muss man niemanden davon überzeugen, es würde viel leichter fallen, Handelsbarrieren im Umgang mit schwierigen Partnern aus anderen Erdteilen aus dem Weg zu räumen, wenn man ihnen gegenüber als Gemeinschaft auftritt. Um diesen Umstand wissen polnische Kosmetikhersteller (wie Bielenda aus Krakau) oder Keramik-Produzenten (beispielsweise die Bunzlauer „Manufaktura“), die seit dem Inkrafttreten des Freihandelsabkommens zwischen der EU und Südkorea im Jahre 2011 exorbitante Exportüberschüsse einfahren. So konnte Bunzlau zu einem europäischen Zentrum für Keramik aufsteigen; Stadt wie Region erleben ihre Blütezeit.
Die Politik ist wieder angesagt
In Brüssel wird in diesen Tagen viel über die erzwungene Rückkehr des Politischen gesprochen. Die europäische Integration wird dabei gewöhnlich als ein Friedensprojekt bezeichnet. Aber wenn zurzeit der Frieden in Europa stärker als zuvor von der außereuropäischen Großwetterlage abhängt, muss man die europäische Außenpolitik anders einordnen. Sie muss mit neuem Sinn gefüllt und mit einem höheren Stellenwert versehen werden. Die EU hat sich lange Zeit nicht für das außereuropäische Ausland interessiert, die europäische Diplomatie ist ja auch erst vor kurzem aus der Taufe gehoben worden. Doch die Spannungen und Konflikte im direkten Nachbarschaftsraum genauso wie die Migrationskrise haben uns keine andere Wahl gelassen. Die Forderung nach einer „Entpolitisierung“ der Gemeinschaft und der überholte Glaube an die alleinige Wirkmächtigkeit von Verfahren und Regeln sind zu einer Utopie geworden. Der lange Urlaub von jeglichen geopolitischen Überlegungen ist gerade abgelaufen. Man darf sich nicht länger nur auf den Schutzschirm der Amerikaner verlassen, man muss deutlich mehr in die eigene Verteidigungsfähigkeit investieren, die zerstreuten Ressourcen bündeln und die eigenen Institutionen noch effizienter machen. Man hört, die Regierungschefs sollten sich intensiv mit der Außenpolitik befassen, und zwar nicht nur in Krisenzeiten, sondern auch im politischen Alltag. Nur dann wird man dieses Politikfeld nicht nur den größten oder wichtigsten Machtspielern überlassen müssen oder – unter einem anderen Blickwinkel betrachtet – dieses Feld zu etwas mehr als nur einer Summe von nationalen Politiken einzelner Mitgliedstaaten umgestalten können.
Die Europäische Union muss jetzt mit all ihrem Stolz auf die eigene Soft Power eine beharrliche Anbahnung rechtlicher Lösungen unter Einsatz einer multilateralen Diplomatie verfolgen; sie muss sich nun entschlossen der neuen Realität stellen: Der Rückkehr der Großmächte und einer multipolaren Welt. Damit geht einher, dass die Union ihre Selbstdarstellung von einer Gemeinschaft, die keine großen politischen Ambitionen hege, revidieren muss. Als zentral erscheinen dabei zwei Aspekte. Erstens, die EU sollte es lassen, sich als die Avantgarde einer liberalen Ordnung zu sehen, ja sich gewissermaßen als den Oberlehrer universeller Werte aufzuspielen. Eine solche Selbstwahrnehmung weicht heute ohnehin vor einem anderen Leitbild zurück – nämlich der EU als einem Akteur, der die Errungenschaften der liberalen Demokratie zu schützen weiß, und zwar vor allem innerhalb der eigenen Gemeinschaft und in seinen Beziehungen zu der Außenwelt, die in großem Maße den Gesetzen der Realpolitik folgt und dabei andere Bezugsgrößen zu beachten hat, als es bei der Union der Fall ist. Zweitens, man sollte sich selbst nicht mehr einbilden, es möge gelingen, die Partner nach eigenem Willen umzustimmen. Ebenso wenig kann man die Nachbarn grundsätzlich wie potenzielle Mitglieder der eigenen Gemeinschaft behandeln und stillschweigend davon ausgehen, sie werden dies auch anstreben.
Ein erster Ansatz für eine angemessene Antwort auf die grundlegenden Veränderungen in der politischen Großwetterlage war die im Juni 2016 beschlossene neue Globale Strategie für die Außen- und Sicherheitspolitik der EU. Diese wird von einem auf Grundsätzen beruhenden, regelbasierten Pragmatismus geleitet und verfolgt weniger anspruchsvolle, dafür aber realistischere Teilziele rund um die Gewährleistung von Stabilität und Sicherheit. Ohne die eigene Prinzipientreue oder demokratische Werte aufzugeben, werden mithilfe der Globalen Strategie einige Kurskorrekturen vorangetrieben, um mit wirksameren Maßnahmen und auf verschiedenen Wegen die europäische Sicht auf die globale Ordnung auf der Grundlage des Völkerrechts geltend zu machen. Die Strategie berücksichtigt den Umstand, dass unsere Partner nicht wie einzelne Bestandteile künstlich gebildeter Schalterstellen in der jeweiligen Region behandelt werden wollen, die einer standarisierten Bewertung unterliegen. Sie fühlen sich unwohl in der ihnen bislang von der westlichen Welt zugedachten Rolle als bevormundete Akteure. Um ihre Nachbarschaftspolitik erfolgreich voranzutreiben, wird die Europäische Union stärker auf die externen Partner zugehen, gemeinsam mit ihnen maßgeschneiderte Reformen abstimmen und diese unterstützen müssen.
Generell muss sich die Union mit der Tatsache abfinden, dass die Staaten in ihrer Nachbarschaft und deren Umgebung mittel- und langfristig eine engere Bindung mit regionalen Mächten eingehen und sich dabei von anderen Wertevorstellungen leiten lassen. Die Glaubwürdigkeit der liberalen Demokratie ist erschüttert, sie erscheint im Allgemeinen nicht mehr attraktiv genug. So hat sich gezeigt, wie selbst in Europa anderweitige Entwicklungskonzepte an Zulauf gewinnen. In diesem Sinne sieht sich die EU einer geopolitischen Einsamkeit ausgesetzt.
Diese unvermeidliche Lektion in Demut und nüchternem Selbstanspruch, der die Grenzen der eigenen Agenda erkennt, birgt jedoch eine wichtige Chance einer neuen Legitimation des Integrationsprojektes. Die „Rückkehr des Politischen“ bedeutet ja keineswegs eine Selbstaufgabe, sondern ist vielmehr als eine Chance zu begreifen, sich der neuen Realität anzupassen und dieser mit Veränderungen zu begegnen. Nicht zuletzt kann man so den Bürgern besser vermitteln, was die EU ihnen gewährt und welche Gefahren sie von ihnen abwendet, mit anderen Worten – wozu es die EU überhaupt gibt und warum es besser ist, ihr anzugehören.
Britische Lektion
Die Entscheidung der Briten über den Austritt aus der EU hat die Überzeugung untergraben, jede Krise nütze der Gemeinschaft. Die alte Lesart, die Union gehe aus jeder Krise nur gestärkt hervor, weil sie in der Lage sei, neue Steuerungsinstrumente für die Zukunft auszuloten, ist seitdem nur eingeschränkt haltbar. Die EU-Brexit-Unterhändler mühen sich an der Schadensbegrenzung für beide Seiten, aber niemand wagt heute zu behaupten, es gelinge am Ende, den Schaden abzuwehren. Die britische Lektion läuft also darauf hinaus, die Beziehungen innerhalb der verbleibenden 27 EU-Mitgliedstaaten so auszurichten, dass die Identität der verkleinerten Gemeinschaft nachhaltig gestärkt wird und die EU aus den Brexit-Verhandlungen handlungsfähiger und krisenfester hervorgeht. Was ist zu tun, damit dies gelingt?
Die europäische Integration wurde zunächst als ein Friedensprojekt forciert mit dem Ziel, durch eine enge wirtschaftliche Verflechtung der Mitgliedstaaten zukünftige militärische Konflikte zu verhindern. Daraus wurden mehrere Handlungspraktiken abgeleitet, die wir bislang sowohl für die mitgliedstaatlichen als auch die nachbarschaftlichen Beziehungen für selbstverständlich hielten. In einer Zeit, in der sich Krisenerscheinungen mehren, werden viele dieser Handlungspraktiken hinterfragt. Etwa die Annahme, enge politische Beziehungen und Handelskooperationen mit EU-Nachbarn würden unweigerlich zu einem Transfer unserer Standards und Werte führen; bloß anstatt einen Werte-Export zu betreiben, haben wir immer wieder eher Chaos importiert. Die europäische Solidarität begann zu bröckeln und die gegenseitige Abhängigkeit, die giftigen historischen Auseinandersetzungen Einhalt gebieten sollte, hat diese gelegentlich noch befeuert. So war das auf dem Höhepunkt der Finanzkrise in der Währungsunion, als historische Aufrechnungsdebatten besonders schwere Schatten über das Verhältnis zwischen Berlin und Athen warfen. Dabei sollte doch die Zusammenarbeit im Euroraum die weitestgehende Form einer praktizierten gegenseitigen Abhängigkeit statuieren und der Flasche mit den Geistern der Vergangenheit einen Korken verpassen. Natürlich nur, wenn der Euroraum sich bewährt.
Die Vollendung der Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) musste daher auf die Prioritätsliste gesetzt werden. Die EU hat darüber hinaus eines erkannt: Sie wird von den Bürgern nicht nur an den Ergebnissen ihres Engagements für den Fortschritt gemessen. Was die EU-Bürger umtreibt, sind die Begleiterscheinungen der Globalisierung, der Einwanderung oder generell des Prinzips der gegenseitigen Abhängigkeit. Sie erwarten von der EU, dass diese ihnen das Gefühl von Sicherheit vermittelt, indem sie entsprechende Mechanismen zum Schutz der als bedroht empfundenen Identität entwickelt. Dies deckt sich generell mit der Forderung, die negativen Folgen der Globalisierung einzudämmen oder gar abzuwenden.
Die heutige europäische Erzählung sollte daher nicht mehr nur an die ursprünglichen Argumente über die Gründung der Gemeinschaft als Friedensprojekt anknüpfen. Sie sollte sich ferner nicht ausschließlich auf finanzielle Leistungen zugunsten der Mitgliedstaaten beschränken. In den Vordergrund rückt heute nämlich der Schutz vor den negativen Auswirkungen der Globalisierung, flankiert durch das Argument, wir werden die gewaltigen Herausforderungen, die bereits jetzt vor uns stehen oder in Zukunft auf uns zukommen, nur gemeinsam bewältigen. Die Botschaft muss daher lauten: Selbst wenn die bestehenden Lösungsansätze nicht mehr greifen (die darauf abzielen, den Widerspruch zwischen der Übermacht der Finanzmärkte und der ihr kaum beizukommenden staatlichen Regulierung zu überwinden), so werden wir gemeinsam an besseren Lösungen arbeiten.
Dem Katalog gebotener Schlussfolgerungen sollte man die Konsequenzen der im Krisenmodus (Finanzkrise, Ukraine-Krise, Migrationskrise) vorangetriebenen Umgestaltung der EU seit 2008 hinzufügen. Die EU richtete damals ihr Augenmerk darauf, all diese Brandherde zu löschen, was ihre tatsächlichen Leistungen in den Hintergrund treten ließ, beispielsweise die Einrichtung von Euro-Rettungsschirmen für verschuldete Staaten oder den Aufbau der Energie- und Bankenunion. Es fehlte an Zeit und Ressourcen, diese Erfolge zu verbuchen und deutlich zu machen, was die EU für ihre Bürger leistet und wie menschennah sie tatsächlich agieren kann. Ohne dieses wichtigste Instrument ihrer eigenen Legitimation ausspielen zu können, wurde die EU vor allem mit Krisen in Verbindung gebracht, was ihr ohnehin bereits angekratztes Ansehen zusätzlich schrumpfen ließ. Zu den wahren Problemen – an denen es wahrlich nicht fehlte – gesellte sich also noch ein weiteres, nämlich die Wahrnehmung der EU als Teil des Problems und nicht der Lösung.
Vor diesem Hintergrund war es mehr als notwendig, das Löschen von Brandherden und den Krisenmodus hinter sich zu lassen und dazu zu übergehen, die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Vor dieser Aufgabe stand nun der Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, der in seiner Rede zur Lage der Union vom September 2017 davon zu überzeugen versuchte, Europa habe wieder Wind in den Segeln. Angesichts des Wirtschaftsaufschwungs, der guten Beschäftigungslage und der europäischen Investitionsoffensive verkündete er das Ende der Krise. Zwar habe auf der politischen Bühne der anti-europäische Populismus an Kräften gewonnen, doch es nicht geschafft, die politische Ordnung Europas ernsthaft ins Wanken zu bringen. Als Reaktion auf diese Populisten-Welle hätte in den meisten Mitgliedstaaten sogar die pro-europäische Stimmung deutlich Aufwind erfahren. Die Befürworter der bisherigen Integrationsleistungen seien in die Offensive getreten. Deshalb rief Juncker dazu auf, den positiven Wirtschaftsausblick und den günstigen Wind zu nutzen.
Juncker spricht sich für eine Synthese liberaler und sozialer Ansätze aus, betont die Bedeutung der Einigung auf eine europäische Säule sozialer EU-Standards und stimmt folgendem Befund zu: Die Konsolidierung eines breit gefächerten Lagers all derjenigen, die für Weltoffenheit und Zusammenarbeit einstehen, sei heute viel wichtiger als weiter das ideologische Korsett zu schüren. Juncker hat ähnlich wie der französische Staatspräsident Emmanuel Macron die Zeichen der Zeit erkannt. Während aber Macron sich für eine Beschleunigung der Integration in einem kleineren Kreis der Eurozone einsetzt (Europa der zwei Geschwindigkeiten), fühlt sich Juncker auf den Plan gerufen, die Integrität der EU der 27 Mitgliedstaaten zu retten. Er versteht zwar, wieso die langsamsten von ihnen das Reformtempo der gesamten Union nicht vorgeben sollten, möchte aber, dass die Einheit der Union gestärkt und nicht durch die verschiedenen Geschwindigkeiten auseinandergetrieben wird.
Der Kommissionspräsident schlägt daher vor, einige Integration fördernde Projekte zu vollenden, vor allem die Wirtschafts-, Währungs- und Bankenunion sowie die Reform des Schengen-Raums. Wenn dabei alle Mitgliedstaaten mitkommen, so wird die Debatte über die Geschwindigkeiten obsolet werden. Damit würden wir einen entscheidenden Schritt in Richtung einer größeren Kohärenz und Integrität Europas tun. Juncker hat erstens an Berlin und Paris ein Angebot mit Vorschlägen übermittelt, die eine Kompromissfindung bei der Vollendung der Bankenunion herbeiführen könnten, ohne die ein umfassender Reformprozess der EWWU bekanntlich nicht eingeleitet werden kann. Zweitens hat er Rumänien und Bulgarien dazu ermuntert, dem Schengen-Raum zügig beizutreten. Und drittens hat er für Länder, die noch außerhalb der Währungsunion verbleiben, einen Maßnahmenkatalog zusammengeschnürt, die den Beitritt zum Euroraum technisch und finanziell unterstützen.
Dieses Angebot richtet sich unter anderem an Polen und weitere Länder der Region, die in Europa der zwei Geschwindigkeiten eine Gefahr sehen. Juncker sendet damit ein sehr klares Signal an diese Länder. Er tut es in einer Situation, wo eine wachsende Zahl der Mitgliedstaaten für eine weitergehende Integration der Union im Euroraum eintritt und gleichzeitig mit dem Gedanken spielt, die weiteren finanziellen Hilfen für die Nettoempfänger in der EU davon abhängig zu machen, ob diese sich bei der Verteilung von Flüchtlingen solidarisch zeigen oder die Missstände bei der Rechtsstaatlichkeit beheben. Juncker gibt damit zu verstehen, die Europäische Kommission – die von ebendiesen Ländern harsch kritisiert wird – sei im Grunde ihr wichtigster Verbündeter. Denn zur Aufgabe der Kommission gehört es, für die Integrität der Gemeinschaft zu sorgen und auf die Bremse zu treten, sobald sich eine Gefahr abzeichnet, diese könnte auseinanderdriften. Die Lage hat sich allerdings zugespitzt, nachdem die Europäische Kommission im Mai 2018 den langfristigen EU-Haushaltsplan für die Jahre 2021–27 vorgelegt hatte.
Bei den EU-Haushaltsverhandlungen wird sich rasch zeigen, dass für Polen – soweit das Land noch länger das Vertragsverletzungsverfahren wegen Verstöße gegen Rechtsstaatlichkeit am Hals haben sollte – nicht die Haltung der Kommission in dieser Frage das eigentliche Problem sein könnte, sondern der Druck seitens der Steuerzahler und Unternehmer auf die Regierungen der Mitgliedstaaten. Vor allem bei den Nettozahlern der EU wird auf die Überprüfung gedrungen, ob das EU-Recht unter den Bedingungen einer vollen politischen Kontrolle über die Justiz geltend gemacht werden könne. Vor diesem Hintergrund werden schon jetzt Vorschläge laut, künftig die Auszahlung von Hilfsgeldern aus Brüssel an die Einhaltung von Rechtsstaatlichkeit-Prinzipien zu koppeln. Es geht dabei nicht einmal darum, inwiefern dies dann überhaupt überprüfbar wäre, noch ob bei der Abstimmung auf der Grundlage des Art. 7.1 des EU-Vertrages („Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der Rechtstaatlichkeit“) die erforderliche Mehrheit der Mitgliedstaaten sich hinter den Rat stellt. Es wäre besser, wenn das Problem der Verletzung gegen die Rechtstaatlichkeit vor der entscheidenden Runde der Haushaltsverhandlungen behoben wäre, denn es schwächt die polnische Verhandlungsposition und verhindert die Fähigkeit, Koalitionen zu schmieden.
Mit Blick auf das Resümee meiner Ausführungen über die Reform und die Umgestaltung der Union darf wohl davon ausgegangen werden, dass man bei diesen Vorstößen eher auf differenzierte statt auf einheitliche Integration nach dem Motto: „Mehr Europa in jedem Bereich“ setzen wird. Die Erstere verspricht schlicht mehr Erfolgsaussichten. Wichtig dabei ist, dass die Vielfalt (die heute ohnehin schon gegeben ist) vor allem die Integration stärkt sowie die Kohärenz des europäischen Rechts und der EU-Institutionen gewährleistet und nicht das Risiko des Auseinanderdriftens der Union erhöht. Die Ideen, Trennwände des europäischen Haues niederzureißen und die nationale Identität und Kulturen der einzelnen Länder zu verwischen, werden nicht greifen. Heute wird es ohnehin von kaum jemand ernsthaft gefordert. Solche Ideen werden wohl nur noch als ein Phantom fortbestehen, das von den Gegnern der Union immer wieder gerne heraufbeschwört wird.
Dass ein solcher Reformweg eingeschlagen wird, ist wohl kaum als ein außerordentliches Ruhmesblatt anzusehen. Noch ist er als eine bereits erledigte Hausaufgabe nach den Erfahrungen rund um den Brexit zu werten. Auch die Brexit-Kampagne selbst kann kaum als ein Beweis für politische Klugheit oder Vernunft herhalten – im Vereinigten Königreich behandelte man die Union allzu häufig wie eine Geisel innerpolitischer Frustrationen und diverser Parteieninteressen. Daraus ergibt sich eher eine klare Lehre: Wenn man sich als EU-Mitgliedstaat darauf einlässt, auf Distanz zur Union zu gehen, also intern einen Exit aushäkelt, geht gleichsam die eigene Glaubwürdigkeit verloren. Und diese braucht man, um den unsäglichen Prozess später einzuhegen oder unter Kontrolle zu halten.
Eigennütziges und gemeinschaftliches Handeln
Aus dem obigen Denkmodell ergibt sich für Polen eine klare Schlussfolgerung, es sei in jedem Fall ratsam, angesichts derzeitiger Vorgänge in Europa zwischen eigennützigem und gemeinschaftlichem Handeln gut abzuwägen. In dem Augenblick, wo die Union wieder erstarkt ist und wichtige Entscheidungen über deren zukünftige Entwicklung anstehen, muss man ernstzunehmende und verlässliche Verbündete um sich scharen und überflüssigen Problemen aus dem Weg gehen. Alles läuft darauf hinaus, einen vertretbaren Kompromiss bei der Frage der Rechtstaatlichkeit zu finden, um bei den Verhandlungen über den mehrjährigen EU-Haushalt koalitionsfähig zu bleiben. Es kommt darauf an, bei der Verfolgung eigener Interessen die Trümpfe, die Polen vormals einen „Mehrwert an Bedeutung“ verliehen, nicht aus der Hand zu lassen. Ebendiesen Trümpfen war es geschuldet, als Warschau im derzeitigen EU-Haushalt für die Jahre 2014–2020 rund 4,5 Milliarden Euro mehr an Hilfsgeldern aus Brüssel für sich herausschlagen konnte, und zwar trotz des Umstands, dass der Haushalt für alle Mitgliedstaaten um rund 40 Milliarden Euro geschrumpft war. Polen galt damals als ein Land, das die EU-Fördermittel rational einsetzte und sich aktiv für die Belange der Gemeinschaft einbrachte.
Die weitere Herausforderung besteht darin, Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten unbedingt zu vermeiden, weil es ein hohes Risiko in sich birgt, an den Rand jeglicher Einflussnahme zu geraten und den Zugriff auf EU-Hilfsgelder zu verlieren. Die mangelnde Beteiligung in den zentralen EU-Politikfeldern versperrt den Weg zur Mitbestimmung über Ressourcen, die demnächst dorthin umgeleitet werden. Sollte man aus diesen wichtigsten Projekten (etwa rund um die Migration oder Verteidigung) auf eigenes Betreiben hin aussteigen, wäre es gleichbedeutend mit dem Ausschluss aus dem Entscheidungskern der Gemeinschaft. Polen hat sich über Jahre einen guten Ruf erworben, indem es als ein Bindeglied zwischen der Eurozone und den EU-Ländern ohne Euro fungierte. Polen trat zwar für eigene Interessen ein, ließ es aber nicht zu, dass die Union zerbröckelte. Damit verfolgte Polen ein wichtiges gemeinschaftliches Ziel. Man hat das Land unterstützt und war seinen Anliegen wohlgesonnen.
Die Union ist kein Paradies auf Erden, aber in unruhigen Zeiten ist es ein ziemlich sicherer Ort. Insbesondere für ein Land, welches Jahrhunderte lang den geopolitischen Gewalten ausgesetzt war und wegen seiner Zwischenlage „östlich vom Westen und westlich vom Osten“ zu leiden hatte. Zu viele Generationen von Polen waren dazu verdammt, ein unstetes Leben in diesem Niemandsland zwischen Ost und West zu führen, um jetzt die Chance auf eine historische Verankerung zu verspielen.
Wir brauchen die Union nicht als eine Utopie, in die wir uns vor den realen Problemen flüchten. Sie ist kein Mythos, der unsere eigenen kulturellen Wurzeln für ungültig erklären oder durch etwas anderes ersetzen soll. Die europäische Integration ist eine zivilisatorische Entscheidung, die dabei hilft, die eigenen Wurzeln zu wahren und sie auch für andere nachvollziehbar zu machen. Die einzige Alternative wäre, sich Mythen und Illusionen hinzugeben, die ein Selbstbild untermauern, das wirklich niemanden interessiert. Nur dass Polen solche Mythen und Illusionen nicht braucht, denn unter anderem die Mitgliedschaft in der Europäischen Union hat dem Land dabei geholfen, sein Selbstwertgefühl zu stärken. Allein schon aus diesem Grund wäre Polen gut beraten, aus dem Kern dieser Gemeinschaft nicht auszuscheiden.
Aus dem Polnischen von Marcin Wiatr
Marek Prawda
Diplomat, ehem. Botschafter der Republik Polen in Deutschland, Leiter der Vertretung der EU-Kommission in Polen.
Der Beitrag gibt ausschließlich die eigene Meinung des Autors wieder.