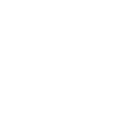Die Zwangsarbeit im Dritten Reich während des Zweiten Weltkriegs ist eines der am wenigsten erforschten NS-Verbrechen, das von polnischem Blut geprägt ist. Unmittelbar nach dem Überfall der Wehrmacht auf Polen begann die Einrichtung von Arbeitsämtern. Am 15. September wurde Hans Frank zum Generalgouverneur ernannt. Unmittelbar nach seinem Amtsantritt verpflichtete er alle Polen zwischen 14 und 70 Jahren zur Arbeit für das Dritte Reich. Massendeportationen begannen. Die Zwangsarbeiter arbeiteten in verschiedenen Wirtschaftszweigen, darunter in der Landwirtschaft, der Rüstungsindustrie, im Baugewerbe und in den Bergwerken, wo sie brutaler Behandlung, Diskriminierung und Repressionen durch ihre "Herren" ausgesetzt waren. Für die kleinsten Vergehen drohten ihnen harte Strafen bis hin zum Tod.
Bei meinen Recherchen über das Schicksal polnischer Zwangsarbeiter in der Bayerischen Staatsbibliothek in München und bei der Lektüre von mehr als fünfhundert Seiten der Archivzeitschrift D.P Express (1946 - 1948) stieß ich auf eine interessante Information vom 07.09.1946 über ein Mahnmal im Dorf Salem am Bodensee. Besonders beunruhigt hat mich die Inschrift unter dem Foto, das ein Steinkreuz, einen verdorrten Baum und einen lebenden Ast zeigt. Und zwar: Ein Pole wurde im Kreis Überlingen gehängt, weil er ein Verhältnis mit einer deutschen Frau hatte. Die Polen in der Gegend haben an der Stelle der Hinrichtung ein Denkmal für ihn errichtet. Auf der rechten Seite ist der Ast zu sehen, an dem er hing. Bezeichnenderweise ist der ganze Baum inzwischen verdorrt, nur der Ast lebt noch.
Ich wollte es nicht so recht glauben und wandte mich an lokale Historiker. Meine weiteren Nachforschungen ergaben, dass das Denkmal noch heute existiert und errichtet wurde, um die Erinnerung an nicht nur einen, sondern zwei ermordete Polen zu bewahren. Beide waren ehemalige Soldaten, die im Septemberfeldzug gekämpft hatten. Sie waren in einem Abstellraum hinter dem Gebäude des Bauern untergebracht. Dieser abgelegene Raum wurde zu einem Ort für heimliche Kontakte mit deutschen Frauen, die von den Deutschen streng verboten waren. Als eine von ihnen schwanger wurde, kam die ganze Angelegenheit ans Licht und die Polen wurden am 03. und 04. Juli 1941 sofort verhaftet. Der Vater des zukünftigen Kindes stellte sich als Eugeniusz Pagacz heraus, der 1913 in Wieluń geboren wurde. Er wurde zunächst in das Internierungslager in Konstanz und dann in das Strafgefängnis in Kislau gebracht. Von dort wurde er am 1. September 1942 an die Gestapo in Karlsruhe überstellt und nach Mimmenhausen transportiert. Er wurde wegen Rassenschande verurteilt und am 2. September 1941 an einer Kreuzung in der Nähe von Salem (Überlingen) durch Erhängen an einem Lindenbaumzweig hingerichtet.
Der Fall des zweiten Polen, der viele Fragen aufwirft, die bis heute ungeklärt sind, liegt anders. Es handelt sich um Ludwik Halczyński, der 1913 in Krakau geboren wurde. Halczyński war verheiratet, hatte einen Bruder, zwei Schwestern und einen Sohn. Vor dem Krieg wohnte er in der Barska-Straße 30. Am 26. August 1941 wurde auch er in das gleiche Lager in Konstanz transportiert, von wo aus er am 6. Februar 1942 in das Konzentrationslager Dachau verlegt wurde und die Häftlingsnummer 29182 erhielt. Am 25. Mai 1942 wurde er aus dem Lager entlassen und ging, wie ein Beamter feststellte, in eine unbekannte Richtung.
Entlassungen von Häftlingen aus dem Konzentrationslager Dachau waren selten, kamen aber unter bestimmten Umständen vor, z. B. bei der Verlegung in andere Konzentrationslager oder Arbeitslager. Obwohl es keinen Vermerk über die Gründe für Halczynskis Entlassung gibt, kann mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass die deutschen Behörden ihn für Propagandazwecke nutzen wollten. Aus Archivdokumenten der Stadt Überlingen geht hervor, dass Halczyński aus Dachau gebracht und am 29. Mai 1942 am selben Ast wie sein Freund Eugen gehängt wurde. Dies wirft viele Fragen auf, die unbeantwortet bleiben. Weshalb wurde Ludwik Halczynski am 6. Februar 1942 in das Konzentrationslager Dachau gebracht? Warum wurde er am 16. Mai 1942 entlassen? Warum hat der Sachbearbeiter diese Verlegung nicht vermerkt, oder wollte man etwas verbergen? Wo hielt er sich vom Zeitpunkt seiner Entlassung aus Dachau bis zum Tag seiner Hinrichtung auf? War er rechtskräftig verurteilt, oder wollte man ihn zur Abschreckung ohne Verurteilung hängen? Oder konnte man ihm nichts nachweisen und die Deutschen wollten ein "sauberes, unfehlbares" Gesicht bewahren?
Die der "Rassenschande" Angeklagten wurden oft öffentlich stigmatisiert, um andere einzuschüchtern und ähnliche Fälle zu verhindern. Öffentliche Prozesse und Bestrafungen sollten abschreckend wirken. So mussten in beiden Fällen etwa 300 Polen von Bauernhöfen in der Umgebung von Salem und Mimmenhausen sowie Einheimische und sogar Kinder an der Schausexekution teilnehmen.
Bei weiteren Recherchen wurde auch ein Fehler in der Schreibweise des Nachnamens Walczynski entdeckt.Verschiedene deutsche Beamte haben ihn in den Standesämtern einmal als Wilczynski, einmal als Walczynski und ein anderes Mal als Halczynski eingetragen.Richtig müsste es heißen Halczynski, geboren am 07.06.1913 in Krakau.Rätselhaft ist auch, dass Ludwiks Sohn 1981 beim Internationalen Suchdienst Arolsen um eine Bescheinigung über den Aufenthalt seines Vaters in einem Konzentrationslager bat.Als Antwort erhielt er aus unbekannten Gründen das falsche Todesdatum und den falschen Todesort, nämlich den 25. Mai 1943 in Dachau.Auf Nachfrage nach der Sterbeurkunde erhielt er die Antwort, dass dies unmöglich sei, da sein Tod nirgendwo in Dachau vermerkt sei.
Polen errichteten ein Kreuz.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs brachten polnische ehemalige Zwangsarbeiter am 14. August 1945 ein Holzkreuz an der Hinrichtungsstätte an und errichteten im Herbst 1946 ein neues Steinkreuz mit polnischer Inschrift auf dem Sockel: Hier wurden folgende Polen gehängt: am 1.9.1941 Eugeniusz Pagacz, geboren 1915, am 25.5.1942 Ludwik Walczyński (Nachname falsch geschrieben), geboren 1913. Passanten, betet ein Ave Maria für die Opfer des Rassenhasses".
Wie der Lokalhistoriker Hugo Gommeringer in seinen Veröffentlichungen beschreibt, ist die Linde nach der Hinrichtung tatsächlich verdorrt, nur der Ast, an dem die Polen hingen, blieb grün.Im Jahr 1955 wurde der völlig verdorrte Baum entfernt und an seiner Stelle ein neuer gepflanzt, der bis heute den Namen Polenlinde trägt.Einige Einheimische sind immer noch davon überzeugt, dass sich hier ein altes Volksmärchen bewahrheitet hat, demzufolge ein Baum verdorrt, wenn ein Unschuldiger an seinem Ast aufgehängt wird.Das Verdorren des Baumes mit dem lebenden Ast, an dem Halczynski und Pagacz aufgehängt wurden, ist Teil dieser Tradition und kann als Symbol für das Unrecht angesehen werden, das den Opfern des Naziregimes widerfuhr.
Das Gedenken bewahren
Im Juni 1960 organisierte der Direktor der Salemer Schule Axel Graf von dem Bussche mit seinen Schülern einen Gedenktag. Als ehemaliger Teilnehmer am Widerstand gegen das Hitlerregime hielt er eine flammende Rede. Ob das Kreuz 1964 - wie Gommeringer schildert - beim Holztransport versehentlich mit dicken Baumstämmen verhakt wurde oder ob die Gedenkstätte absichtlich gewaltsam völlig verwüstet wurde, lässt sich nicht feststellen.
Noch im selben Jahr ließ Max Markgraf von Baden ein neues aufstellen, das feierlich eingeweiht wurde. Im Jahr 1985 wurde auf Initiative des örtlichen Pfarrers Herbert Geil ein bronzener Corpus Christi an dem Kreuz angebracht.Die Jahre vergingen und wieder kümmerte sich niemand um das Mahnmal, geschweige denn um den Gedenktag.Dem Lokalhistoriker Hugo Gommeringer, der das Kreuz 2002 in einem beklagenswerten Zustand vorfand, lag die Angelegenheit so sehr am Herzen, dass er das Schicksal der Polen und die Geschichte des Kreuzes eingehend recherchierte, und obwohl nur wenige Einheimische wussten, was damals geschehen war, wollte sich niemand austoben und schwieg. Er veröffentlichte die Ergebnisse seiner Forschungen in einer Dokumentationsbroschüre, und mit dem Erlös aus deren Verkauf wurden das Denkmal und seine Umgebung im Jahr 2005 gründlich restauriert. Die Schirmherrschaft über die Gedenkstätte wurde von der Gemeinde übernommen und die letzte Restaurierung des Kreuzes wurde 2015 durchgeführt. Obwohl das Gedenken an die Opfer seither aufgegeben wurde, werden am Mahnmal ständig Blumen und Kerzen aufgestellt und die Umgebung gepflegt. Wiederholte Anfragen von Gommering bei der Gemeindeverwaltung oder der örtlichen Schule, einen Gedenktag zu organisieren, bleiben unbeantwortet. Der Historiker wirbt ständig für die Bedeutung dieser Gedenkstätte und unterstreicht sie mit diesen Slogans: Das Kreuz ist nicht nur ein Symbol gegen das Vergessen von unmenschlicher Gewalt, Faschismus, Krieg und Unrecht, sondern auch ein außergewöhnliches Mahnmal für den Frieden, das zu Toleranz, Mut und sozialem Engagement aufruft.
Andreas Bialas, München
Fußnoten:
Denk und Mahnmal in Salem - Polenkreuz und Polenlinde Zeichen des Friedens von Hugo Gommeringer - Ostern 2006
Archiv Internationaler Suchdienst Bad Arolsen Aktenzeichen: 7619660; 1072479
DP-Express-Magazin Nr. 35 vom 07.09.1946 Seite 6 aus dem Archiv der Bayerischen Staatsbibliothek in München